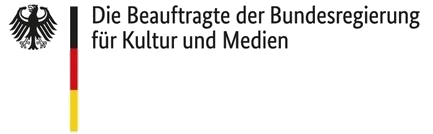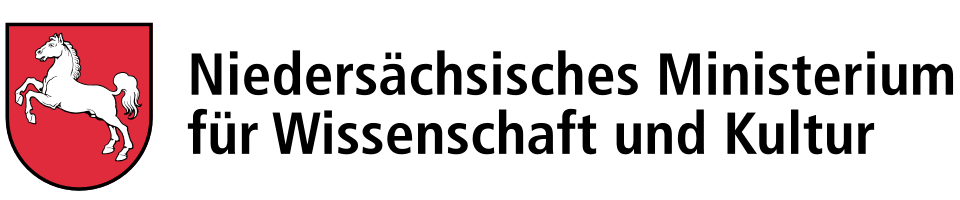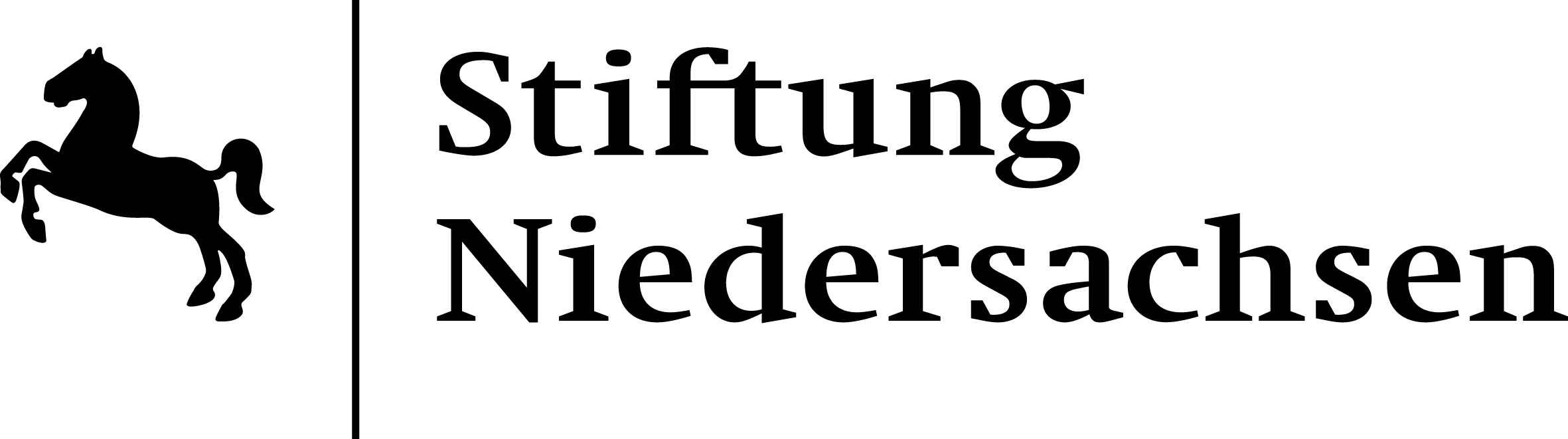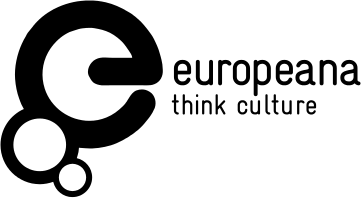Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
von 1751 bis 1829
Externe Links
→ Wikipedia
→ GND
→ VIAF
→ Library of Congress Name Authority File
Entity Facts
→ Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek→ Bibliothèque nationale de France
→ Wikipedia (Deutsch)
→ Wikipedia (English)
→ Frankfurter Personenlexikon
→ Kalliope Verbundkatalog
→ Archivportal-D
→ Neue Deutsche Biographie (NDB)
→ Deutsche Digitale Bibliothek
→ Hessische Biografie
→ Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen Neuzeit
→ NACO Authority File
→ Virtual International Authority File (VIAF)
→ Wikidata
→ International Standard Name Identifier (ISNI)
Quelle: Entity Facts
Wikipedia
Der folgende Text sowie das Bild werden automatisiert aus der deutschen Wikipedia abgerufen. Um Links in dem Wikipedia-Artikel folgen zu können, klicken Sie bitte oben auf → Wikipedia.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, genannt Goethe-Tischbein (* 15. Februar 1751 in Haina (Kloster); † 26. Februar 1829 in Eutin) war ein deutscher Maler aus der hessischen Malerfamilie Tischbein.
Leben
Der Sohn des Hainaer Klosterschreiners Johann Conrad Tischbein (1712–1778) war ab 1765 zunächst Schüler seines Onkels Johann Heinrich Tischbein des Älteren in Kassel, danach bei seinem Onkel Johann Jacob Tischbein in Hamburg. Da ihn das Gebiet der reinen Landschaftsmalerei jedoch nicht interessierte, wechselte er zu seinem Vetter Johann Dietrich Lilly, der in Hamburg als Kunsthändler, Kopist und Restaurator tätig war und Tischbein an die Historienmalerei heranführte. Außerdem bot sich hier für Tischbein die Möglichkeit, alte Meister zu studieren. 1771 unternahm er eine Studienreise nach Holland und kehrte 1773, nach einem kurzen Aufenthalt in Bremen, 1773 nach Haina zurück. Auf Vermittlung der Landgräfin Philippine von Hessen-Kassel Kam Tischbein dann an den Berliner Hof, wo er ab 1777 erfolgreich als Porträt-Maler arbeitete. Dort wurde er 1778 in die Freimaurerloge Zur Eintracht aufgenommen.
Wie viele seiner Malerkollegen strebte Tischbein einen Studienaufenthalt in Italien an. Seinen ersten Aufenthalt in Rom konnte er 1779 mit einem Stipendium der Kasseler Akademie antreten. Dabei vollzog er nach einem intensiven Studium antiker Kunstwerke die Wende vom Stil des Rokoko zum Klassizismus. Er malte hier Landschaftsbilder, Historiengemälde und Stillleben. 1781 musste er aus Geldnot den Rom-Aufenthalt abbrechen. Er wandte sich danach nach Zürich, wo er im Kreis des Physiognomen Johann Caspar Lavater und des Philologen Johann Jakob Bodmer wirkte. Insbesondere Tischbeins Kontakt zu Lavater bewirkte dann offenbar die radikale Änderung seiner Malweise und seine Hinwendung zu historischen Themen und den Theorien über den Wert physiognomischer Studien. Außerdem knüpfte er von Zürich aus erste Kontakte zu Johann Wolfgang von Goethe.
1783 konnte er nach Rom zurückkehren, nachdem ihm durch Goethes Vermittlung von Herzog Ernst II. von Gotha-Altenburg ein weiteres Stipendium von 100 Dukaten jährlich bewilligt worden war. Bei diesem zweiten Italien-Aufenthalt, der bis 1799 dauerte, freundete er sich 1786 mit dem inkognito reisenden Goethe an, mit dem er 1787 nach Neapel reiste (vgl. Italienische Reise). 1786 entstand auch das berühmte Gemälde Tischbeins, das Goethe als Reisenden in der römischen Campagna zeigt und das zum Inbegriff der Sehnsucht nach Arkadien wurde. Es gelangte später nach Deutschland und wurde 1887 von der Bankiers-Familie Rothschild dem Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt am Main geschenkt, wo es noch heute zu sehen ist.
Vom Herbst 1789 bis 1799, als französische Truppen in Neapel einmarschierten, war Tischbein Direktor der noch heute bestehenden dortigen Kunstakademie (Accademia di Belle Arti).
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1799 gründete Tischbein in Göttingen eine Zeichenakademie für Damen, an der von 1799 bis 1801 auch Tischbeins Neffe Wilhelm Unger tätig wurde. Nachdem er 1801 geheiratet hatte, wurde er in Hamburg ansässig und entwickelte Konzepte, hier seine kunstpädagogische Tätigkeit mit einer Zeichenschule fortzusetzen. Zwar traten junge Künstler wie Philipp Otto Runge und Friedrich Overbeck mit ihm in Verbindung, doch als sich der Hamburger Senat weigerte, die geplante Kunstschule finanziell zu unterstützen, nahm Tischbein 1808 ein Angebot von Peter I., dem Prinzregenten von Oldenburg an, der ihn zum Hofmaler und Galeriedirektor ernannte. Außerdem kaufte er die Gemäldesammlung Tischbeins für seine eigene Sammlung. Tischbein wurde daraufhin bis zu seinem Tod 1829 in Eutin, der Sommerresidenz des Großherzogs, ansässig, wo er die Söhne des Herzogs und der Gesellschaft im Zeichnen unterrichtete. Es folgten weiterhin Schüler, die sich auf den Besuch von Akademien vorbereiten wollten. Zu ihnen gehörten Ferdinand Flor, Nicolaus Lescow, Carl Andreas Goos und Jacob Gensler.
Tischbeins Grab findet sich in Eutin auf dem Friedhof in der Plöner Straße. Eine Gedenktafel über seinem ehemaligen Wohnhaus in der Stolbergstraße 8–10 erinnert an den Künstler. Einige seiner großformatigen Gemälde sind im Schloss und im Ostholstein-Museum Eutin ausgestellt. Aus seiner Zusammenarbeit mit der Eutiner Ofenmanufaktur Niemann sind zahlreiche Öfen erhalten.
Weniger bekannt ist das literarische Schaffen Tischbeins, seine Autobiographie Aus meinem Leben (niedergeschrieben seit 1810) und seine von Goethe hoch geschätzten Briefe. Dieser Teil seines Œuvres wird in der Studie des Schriftstellers Friedrich Ernst Peters gewürdigt, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829).
Familie
Tischbein heiratete 1806 die aus Haina stammende Anna Martha Ketting (1775–1832) und hatte mit ihr fünf Töchter und einen Sohn. Tochter Susanna heiratete später den oldenburgischen Hofmaler Heinrich Strack, ihren Cousin. Der Sohn Peter Friedrich Ludwig Tischbein war Förster und Naturforscher.
Ausstellungen (Auswahl)
- 2019: Hamburger Schule – Das 19. Jahrhundert neu entdeckt (12. April bis 14. Juli), Hamburger Kunsthalle
Werke
Gemälde (Auswahl)
- Goethe in der Campagna, Öl auf Leinwand, 1787, 164 × 206 cm, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main.
- Goethe am Fenster der römischen Wohnung am Corso, Aquarell, Kreide und Feder über Bleistift / Papier, 1787, 41,5 × 26,6 cm, Goethe-Museum, Frankfurt am Main.
- Die Stärke des Mannes (Vernunftbild), Öl auf Leinwand, 1821, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg.
- Brutus entdeckt die Namen seiner Söhne auf der Liste der Verschwörer und verurteilt sie zum Tode, nach 1783, Öl auf Leinwand, 156 × 206 cm, Kunsthaus Zürich.
- Porträt Elisa von der Recke, Öl auf Leinwand, um 1775, 60,5 × 48 cm, Städtische Galerie Dresden, (Inv.-Nr. 1980/k45).
- General Bennigsen mit seinem Stab, 1816, Hamburger Kunsthalle
Zeichnungen
- Das verfluchte zweite Kissen, Tintenzeichnung, 1787, 19,7 × 26,9 cm, Stiftung Weimarer Klassik
Schriften
- Der Schwachmatikus und seine vier Brüder (Bruchstück eines Romans.) In: Vaterländisches Museum, Bd. 2, Heft 1, Friedrich Perthes, Hamburg 1811, S. 74 ff., (Digitalisathttp://vorlage_digitalisat.test/1%3D~GB%3DLGhPAQAAMAAJ~IA%3D~MDZ%3D%0A~SZ%3DRA1-PA74~doppelseitig%3D~LT%3D~PUR%3D)
- Aus meinem Leben, C. A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig 1861, (Digitalisathttp://vorlage_digitalisat.test/1%3D~GB%3DhuZEAQAAIAAJ~IA%3D~MDZ%3D%0A~SZ%3DPA1~doppelseitig%3D~LT%3D~PUR%3D), (Aus meinem Leben bei Zeno.org.); Neuausgabe, hg. v. Kuno Mittelstädt, Henschelverlag, Berlin 1956.
Literatur
- Elfriede Heinemeyer: Tischbein, Johann, Heinrich Wilhelm. In: Hans Friedl u. a. (Hrsg.): Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg. Hrsg. im Auftrag der Oldenburgischen Landschaft. Isensee, Oldenburg 1992, ISBN 3-89442-135-5, S. 755 f. (online).
- Christian Gottlieb Heyne, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Homer nach Antiken gezeichnet. Heinrich Dieterich, Göttingen 1801, (Digitalisat).
- Klaus Langenfeld: Wilhelm Tischbein, Goethe-Maler in Rom und herzoglich oldenburgischer Hofmaler. Isensee Verlag, Oldenburg 2008, ISBN 978-3-89995-548-4.
- Alfred Lichtwark: Das Bildnis in Hamburg, II. Bd., Druckerei A.-G., Hamburg 1898, S. 42 ff., (Digitalisat).
- Petra Maisak: Goethe und Tischbein in Rom. Insel Verlag, Frankfurt a. Main/Leipzig 1994, ISBN 3-458-19251-4, (Insel-Bücherei 1251).
- Christoph Andreas Nilson: Über deutsche Kunst: oder biographisch-technische Nachrichten von den ..., Jenisch und Stage'schen Verlagsbuchhandlung, Augsburg und Leipzig 1833, S. 118 ff., (Digitalisat).
- Friedrich Perthes (Hrsg.): Vaterländisches Museum. 1810–1811, Bd. 1, Verlag Perthes, Hamburg 1810, S. 230–242, Gemählde von Wilhelm Tischbein, „Hektors Abschied von Andromache“, „Kassandra“ und „Lasset die Kindlein zu mir kommen“, (Digitalisat, Universitätsbibliothek Bielefeld).
- Ulrich Schulte-Wülwer: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und seine Schüler in Eutin, in: Nordelbingen, Bd. 81, 2012, S. 39–71. ISSN 0078-1037
- Hans Vollmer: Tischbein, Wilhelm. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 33: Theodotos–Urlaub. E. A. Seemann, Leipzig 1939, S. 213–215.
- Christoph Martin Wieland (Hrsg.): Der Neue Teutsche Merkur, II. Band, Gebrüder Gädicke, Weimar 1800, 9. Stück. September 1800, S. 61 ff.(Digitalisat).
Weblinks
- Literatur von und über Johann Heinrich Wilhelm Tischbein im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke von und über Johann Heinrich Wilhelm Tischbein in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Suche nach „Johann Heinrich Wilhelm Tischbein“ im Portal SPK digital der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- Werke von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein bei Zeno.org.
- Goethe in der Campagna auf Postkarten
- Biografie Gemäldegalerie Alte Meister Kassel
- Biografie Ostholstein-Museum
- Hartmut Döhl: „Der Traum von den Helden Homers“ von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Vorstellung eines am 2. September 2007 gehaltenen Vortrages im Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Göttingen, zuletzt abgerufen am 8. Mai 2017.